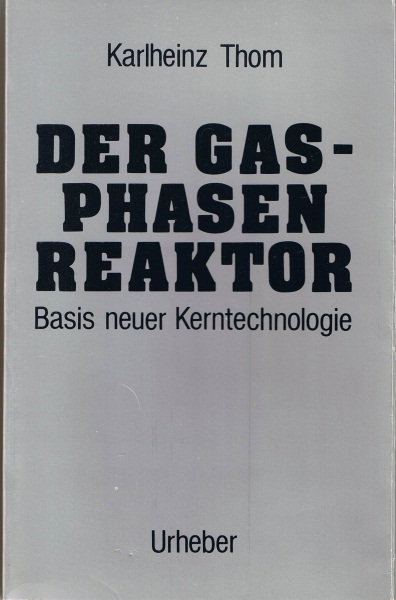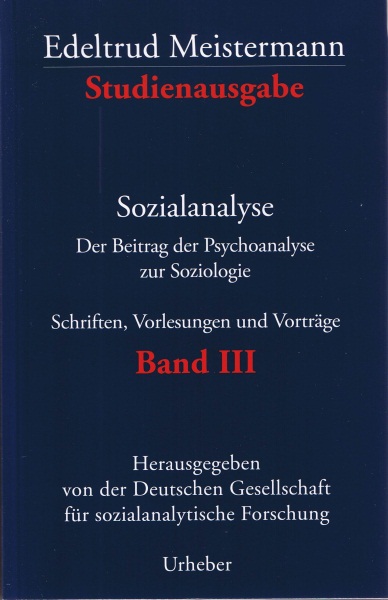Dankesrede von Toby E. Rodes anläßlich der Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille
Dankesrede von Herrn Toby E. Rodes
Lieber Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Freunde,
zunächst möchte ich Ihnen, Herr Ministerpräsident, sehr herzlich danken für den
Rückblick auf mein bisheriges Leben, ganz so habe ich das noch nie gemacht. Dankbar bin ich und, ehrlich gesagt, ein bißchen stolz über
die
Ehre, die Sie und die hessische Landesregierung mir mit der Verleihung
dieser hohen Auszeichnung erweisen. Aber erlauben Sie mir zu sagen, daß
mich die dadurch ausgedrückte Anerkennung meiner Arbeit noch mehr
freut.
Meine Damen und Herren,
im Hinblick auf die derzeitige weltpolitische Lage finde ich es bedeutsam, daß diese Auszeichnung einem Amerikaner zuteil wird, der in
Hessen geboren ist, von wo aus vor 230 Jahren 17.000 von ihrem
Landgrafen vermietete Soldaten dem englischen König zu helfen versuchten, seine amerikanischen Kolonien zu behalten. Das mißlang
bekanntlich und gab einen Anstoß für die Verabschiedung der
Unabhängigkeitserklärung von 1776, welche die Basis für die heute als
selbstverständlich erachteten demokratischen Menschenrechte darstellt.
Eine aktuellere Verbindung, vielleicht besser gesagt: Parallele, zwischen Hessen und den USA, ist die Tatsache, daß Sie, Herr
Ministerpräsident Koch, in der kleineren Stadt Wiesbaden und nicht im
nahen Frankfurt am Main, der Finanzhauptstadt der Bundesrepublik, residieren und Governor George E. Pataki ein gleiches Amt in der
kleinen
Stadt Albany, und nicht in der für amerikanische Verhältnisse nahen
USA-Finanzmetropole New York City ausübt.
Zwischen den beiden Finanzzentren gibt es heute noch eine weitere Ähnlichkeit: das sind die Silhouetten von Frankfurt am Main und Lower
Manhattan, rund um die Wallstreet, in der ich mein Lehrjahr in der Bank
of the Manhattan Company verbrachte, eine der ältesten Banken Amerikas, an der damals die Hamburger Bankiers Warburg maßgeblich beteiligt
waren.
Aber gestatten Sie mir zunächst einen kurzen Ausflug in die Welt der
Definitionen. Da ich mich von den – mit Verlaub gesagt – typisch
deutschen bürokratischen und teilweise praxisfremden Spielereien mit der
offiziellen deutschen Rechtschreibung distanziere, benutze ich die
1982er Ausgabe des allwissenden Duden. Er definiert Demokratie etwas lapidar: „aus dem griechischen und mittellateinischen stammend, als
Volksherrschaft mit den Bedeutungen:
1.a politisches Prinzip, nach dem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat beteiligt ist, und
1.b Regierungssystem, in dem die vom Volk gewählten Vertreter die Herrschaft ausüben, und
2. als Staat mit demokratischer Verfassung, demokratisch regiertes Volkswesen sowie
3. als Prinzip der freien und gleichberechtigten Willensbildung und Mitbestimmung in gesellschaftlichen Gruppen.
Ohne mir dessen von Anfang an bewußt zu sein, habe ich eigentlich mein Leben lang in irgendeiner Form „im Dienste der Demokratie“ gestanden.
Dazu trug sicherlich schon meine multikulturelle Familie bei:
mütterlicherseits englisch aus altem adligen Geschlecht und deutsch/jüdisch aus sehr altem Geschlecht – väterlicherseits
amerikanisch in der 4. Generation und ungarisch, wie Herr Koch schon
erwähnte. Unser Familienleben war in jeder Hinsicht sehr demokratisch. Vater war als Chef einer international arbeitenden Firma viel auf
Reisen. Mutter, ehemals die sehr bekannte Schauspielerin Olivia Veit,
war in der Hirnforschung engagiert und fand, daß ich schon vor dem Besuch der Bornheimer Volksschule in Frankfurt lesen und schreiben
können sollte. Mit 8 Jahren trat ich in das humanistische
Lessinggymnasium ein, verließ es mit 14, als das Verdummungskonzept der Nazi-Professoren unerträglich wurde, und machte mit 16 mein englisches
Abitur in der französischen Schweiz. Bis dahin hatten wir die meisten
Ferien in Italien verbracht.
Die Vielseitigkeit der erlebten Kulturen machte mich neugierig auf die Welt und ihre gesellschaftlichen Formen. Daß nicht nur Diktatur und
Monarchie, sondern auch die Demokratie ihre Haken haben, wurde mir
schon im humanistischen Geschichtsunterricht bewußt. Die Athener, die wir –
zunächst als Gegenspieler zu den braven und weniger braven Autokraten
in Sparta und Korinth – Demokraten nannten, entpuppten sich für mich als
Oligarchen. Und die römische Oligarchie, die mit ihrem allseits
präsenten, propagandistischen Akronym S.P.Q.R. (Senatus Populus Que
Romanus) so tat, als ob sie namens des Senats und des römischen Volkes
regiere, erwies sich als ein mieses populistisches Verdummungstheater.
Daß auch mit der modernen Demokratie etwas nicht stimmen konnte, wurde uns von Stalin, Mussolini und Hitler vor Augen geführt, denn sie waren
legal gewählt worden. Und als ich kurz vor meinem 18. Geburtstag nach
New York kam, wurde ich gewahr, daß auch in Amerika das mit der Demokratie immer noch nicht richtig funktionierte – trotz der
Unabhängigkeitserklärung von 1776, die ja demokratisch die Gleichheit
und individuelle Freiheit aller Menschen statuiert.
Mir wurde klar: das Dilemma der Demokratie besteht darin, daß der Mensch
ein Herdenwesen ist. Wie die Schafe und Zugvögel, zum spitzen Dreieck
formiert, folgt die Masse dem Leittier. Und wenn dieses eine populistische Ausstrahlung hat, folgt ihm das Gros der Herde
blindlings.
Die Geschichte beweist es: Lebewesen verachtende, machthungrige Leithammel wie Hitler, Stalin, Napoleon usw. wurden von einer
demokratischen Mehrheit der Horde erwählt. Danach war es zum
Entgegenwirken zu spät. Diese Erkenntnis leitete mich bei meiner fünfjährigen kommunikativen Arbeit im Dienst der Demokratie im
Nachkriegsdeutschland und in der Bundesrepublik.
Zur Hilfe kamen mir dabei auch Erfahrungen aus meiner Jugendzeit. Im
Konfirmandenunterricht unseres Pfarrers Fresenius. (er war Mitglied der bekennenden Kirche und hatte damit etwas gemein mit Wilhelm Leuschner), pesterte ich ihn mit zu vielen Fragen, zum Beispiel: wieso die Geburt
Jesu just auf den Tag der Wintersonnenwende datiert wurde, obwohl doch
damals ein anderer Kalender galt. Damit der Unterricht nicht mit
solchen Fragen gestört wurde, verbannte er mich in seine große Bibliothek, wo
ich nach Herzenslust meine etymologischen Betrachtungen anstellen
konnte. Aus diesen Studien blieb mir bis heute das Bewußtsein um die
Verarmung der Sprachen und die inhaltliche Veränderung der Wörter und besonders die auch mir daraus erwachsende Komplexität bei der
Übersetzung von einer in eine andere Sprache.
Nehmen wir zum Beispiel die Worte „erfinden“ und „entdecken“: was ich erfinde, gab es noch nicht, was ich entdecke, war schon einmal da.
Heute
werden ln der deutschen Umgangssprache beide Wörter für beides verwendet. In der lateinischen Fassung der Bibel wird Maria, die Frau
Josephs und Mutter seiner Kinder, als „virgo“ dargestellt. In der
deutschen Übersetzung wird sie zur Jungfrau, ein Begriff der dann von der katholischen Kirche als unbefleckte Mutter interpretiert wurde.
Mit der Bibelübersetzung setzten Martin Luther und die anderen
Reformatoren unbewußt eine aufklärende und demokratisierende Revolution
in Gang. Bis dahin war in Europa die Bibel in einer Fremdsprache gehalten, die nur die Geistlichen und die von ihnen erzogenen und
überwachten Adligen lesen konnten. Gutenbergs Revolution der
Kommunikation durch die Einführung des Buchdrucks löste dann die Verbreitung des neuen Wissens aus. Weder die katholische Kirche noch
die
regierenden Adligen konnten die mit der Gedankenfreiheit ausbrechende Diskussion über Lebensregeln und Moral verhindern. Aus dieser
demokratischen Entwicklung entstanden dann die protestantischen
Strömungen, Kirchen und Sekten. Von den letzteren geraten leider heute in Amerika immer mehr unter die Fuchtel faschistoider, populistischer
Gurus.
Eine Folge dieser Entwicklung ist, daß sich die meisten Anführer politischer Parteien, ähnlich wie die Kirchenvertreter, hinter
Ideologien verstecken, wenn Schwierigkeiten auftauchen. In diesem
Zusammenhang möchte ich im Schillerjahr auszugsweise aus dem ersten Brief zitieren, den Schiller unter dem Titel „Von der Schönheit zur
Freiheit“ 1793 dem dänischen Erbprinzen Herzog Friedrich Christian von
Holstein-Augustenburg schrieb:
„Über diejenigen Ideen, welche in dem praktischen Teil des Kantischen Systems die herrschenden sind, … sind die Menschen … von jeher einig
gewesen. Man befreie sie (die Ideen) von ihrer technischen Form, welche
die Wahrheit dem Verstande versichtbart, … dem Gefühl (aber)
verbirgt“, und „sie werden als die verjährten Aussprüche der gemeinen
Vernunft und als Tatsachen des moralischen Instinktes erscheinen, den die weise Natur dem Menschen (solange) zum Vormund setzte, bis die
helle
Einsicht ihn mündig macht.“
Die von Schiller im Verlauf des Briefes aufgezeigte, durch Abstraktion bedingte Inhaltsveränderung der Wörter – das, was er als „technische
Form“ bezeichnet – betrifft auch viele Politiker. Was deren
Kommunikation noch zusätzlich negativ beeinflußt, ist ihr achtloser und oft auch bewußt vager Umgang mit ihrer Muttersprache. Je größer die
Zahl
der Begriffe, die ein Wort enthält, desto weniger kann eine echte vollständige Kommunikation zustande kommen.
Dazu paßt das aus Amerika übernommene, aber auch dort bereits
verfälschte Konzept der sogenannten politischen Korrektheit, also den
Bürgern zu sagen, was wirklich Sache ist. Stattdessen kapseln sich die meisten gewählten Leitcliquen ab, aber proklamieren lauthals das
desinformierende Motto „Bürgernähe“. Und, da sie schon an die nächste
Wahl denken, wird schwer gepanschter Wein ausgeschenkt, der bekanntlich einen schweren, aber eben keinen klaren Kopf macht.
Das heißt: es findet keine echte Kommunikation statt, obwohl der demokratische Bürger eigentlich die – wenn auch traurige – Wahrheit
erfahren möchte. Wie vor 60 Jahren ist immer noch das Gebot der Stunde,
was Michael Bockemühl in seinem Vorwort zu Schillers Briefen „Von der Schönheit zur Freiheit“ schreibt – nämlich:
„Anstöße für die
Entwicklung
des Einzelnen zu erfahren – frei von jeglicher ideologischer Fixierung –
und für die Selbstentwicklung Verantwortung zu ergreifen, statt
weiterhin auf staatliche oder religiöse Fremderziehung zu setzen“.
Meine Damen und Herren,
ich will hier keine Geschichtserinnerung betreiben und mich schon gar nicht auf das derzeitige demokratisch Chaos in Deutschland einlassen,
sondern auf meine Überzeugung hinweisen, daß es keine Demokratie ohne
echte vollendete Kommunikation auf allen gesellschaftlichen Ebenen geben
kann. Dies auf der politischen Ebene zu erreichen, setzt aber äußerste
Kompromißwilligkeit der Beteiligten voraus.
Diese gehört zur angelsächsischen Kultur, zu der auch gehört, daß Debattieren in den Colleges gelehrt wird. Auf dem europäischen
Kontinent
sind einzig die Schweizer traditionsgemäß kompromißwillig, obwohl auch sie sich manchmal damit schwer tun. Ich habe dieses Thema in meinem
gerade erschienenen Buch ausführlicher behandelt. Damit die
kommunikative Grundlage der Demokratie eines Tages geschaffen wird –
ich bin überzeugt, daß dies möglich ist, wenn auch in weiter Ferne -,
müssen
sich alle erziehenden und lehrenden Menschen in den Dienst der
Demokratie stellen, indem sie die Grundzüge der echten vollendeten Kommunikation befolgen, pflegen und lehren.
Und das, meine Damen und Herren, fängt damit an, daß man in der Konversation, in der Debatte, im privaten wie im öffentlichen Leben
erst
einmal im gegenseitigen Respekt den Mund hält und aufmerksam zuhört, wenn der Mensch gegenüber etwas sagt. Ein sofort möglicher Schritt in
die richtige Richtung wäre, wenn jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer
an einer kontinental-europäischen Talkshow, die dieses Gebot verletzen, sich bei den anderen Teilnehmern und dem Publikum entschuldigend als
Buße allen Anwesenden eine Runde spendieren muß! Das ergäbe hierzulande
allerdings jeweils viele Runden und wäre recht teuer!
Ich danke Ihnen.